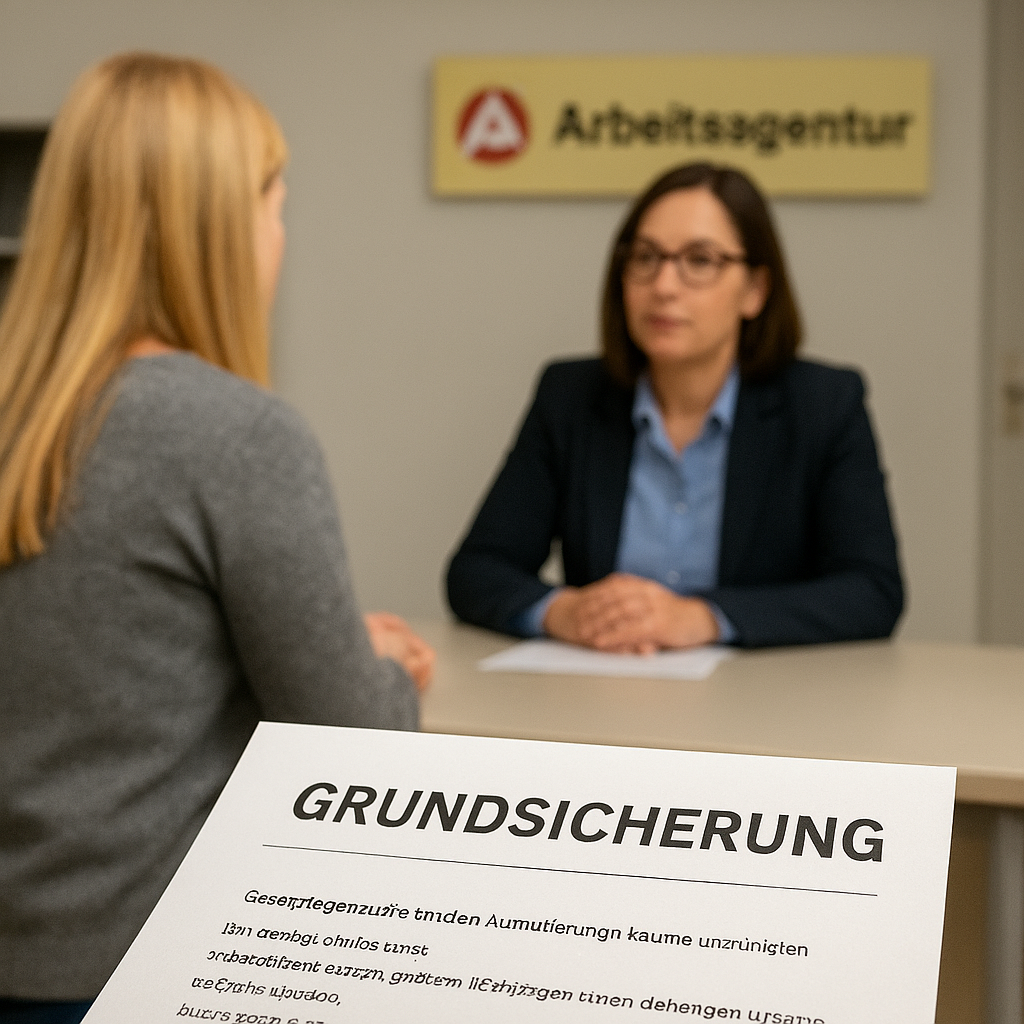Die Bundesregierung hat einen neuen Gesetzentwurf zur Reform des Bürgergelds vorgelegt. Ziel ist es, das bisherige System durch eine „Neue Grundsicherung“ zu ersetzen. Doch während die politische Rhetorik von Milliardenersparnissen spricht, zeigt der Entwurf des Bundesarbeitsministeriums unter Leitung von Bärbel Bas ein anderes Bild: „Keine nennenswerten Einsparungen“.
Was steht im Entwurf?
Der Gesetzentwurf sieht vor, das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung zu ersetzen, die stärker auf Mitwirkungspflichten und Sanktionen setzt. Wer zumutbare Arbeit ablehnt oder Fördermaßnahmen abbricht, soll künftig mit Leistungskürzungen von bis zu 30 Prozent für drei Monate rechnen. Auch Terminversäumnisse sollen härter bestraft werden.
Zudem wird der sogenannte Vermittlungsvorrang wieder eingeführt: Arbeitssuchende sollen vorrangig in Beschäftigung gebracht werden – auch wenn diese nicht ihrer Qualifikation entspricht. Damit kehrt die Reform von einem Fokus auf Weiterbildung und nachhaltige Integration zurück zu einem eher kurzfristigen Arbeitsmarktzugang.
Die Zahlen: Ernüchterung statt Milliarden
Trotz dieser Verschärfungen rechnet das Ministerium mit Einsparungen von lediglich 86 Millionen Euro im Jahr 2026 und 69 Millionen Euro im Jahr 2027. Ab 2028 wird sogar mit Mehrausgaben gerechnet – rund zehn Millionen Euro jährlich. Bei Gesamtausgaben von über 50 Milliarden Euro für das Bürgergeld entspricht das einem Einsparpotenzial von weniger als 0,2 Prozent.
Diese Zahlen stehen im krassen Gegensatz zu den Ankündigungen von CDU-Chef Friedrich Merz, der im Wahlkampf von bis zu zehn Milliarden Euro Einsparungen sprach. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigte sich überzeugt, dass „sehr viele Milliarden“ eingespart werden könnten – eine Einschätzung, die durch den Entwurf nicht gedeckt wird.
Politische und gesellschaftliche Implikationen
Die Reform ist nicht nur ein technisches Update, sondern ein Symbol politischer Machtverschiebung. Die SPD hatte das Bürgergeld einst eingeführt, um sich vom Hartz-IV-Erbe zu lösen. Nun wird es unter einer schwarz-roten Koalition wieder verschärft – mit dem Ziel, „Totalverweigerer“ stärker zu sanktionieren.
Doch Kritiker warnen vor einem „Drehtüreffekt“: Menschen werden in schlecht bezahlte, instabile Jobs gedrängt und landen nach kurzer Zeit wieder in der Grundsicherung. Eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt gelingt so kaum. Auch psychisch Erkrankte könnten durch die neuen Sanktionen zusätzlich belastet werden.
Fazit: Reform ohne Reformwirkung?
Der Entwurf des Arbeitsministeriums zeigt, dass härtere Regeln allein keine nennenswerten Einsparungen bringen. Echte Effekte wären nur durch eine bessere Wirtschaftslage und gezielte Qualifizierungsmaßnahmen zu erwarten. Die Reform bleibt damit ein politisches Signal – aber kein finanzieller Durchbruch.