Am 2. Mai 2025 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Alternative für Deutschland (AfD) offiziell als “gesichert rechtsextremistisch” eingestuft. Diese bedeutsame Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der Bewertung der Partei durch staatliche Sicherheitsbehörden. Der folgende Beitrag beleuchtet die historischen Parallelen zwischen der AfD und der NSDAP, mit besonderem Fokus auf strukturelle und ideologische Gemeinsamkeiten. Dabei werden die Lehren aus der Geschichte für unsere heutige Demokratie reflektiert. Wir analysieren die Entwicklung der AfD, die Gründe für ihre Einstufung und ziehen Vergleiche zu historischen Mustern, ohne dabei die unterschiedlichen Kontexte zu vernachlässigen.
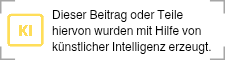
Aktuelle Entwicklung: AfD als gesichert rechtsextremistisch
| Umfassendes Gutachten Ein 1.000-seitiges Gutachten diente als Grundlage für die Neubewertung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz | Verdichtung zur Gewissheit Der bisherige Verdacht hat sich nach eingehender Prüfung “zur Gewissheit verdichtet” | Verfassungsfeindlichkeit Festgestellte Verstöße gegen die Menschenwürde sowie das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip |
Die neue Einstufung ist das Ergebnis einer mehrjährigen Beobachtung und Analyse durch den Verfassungsschutz. Sie bedeutet, dass die Behörde die AfD nun mit Gewissheit als eine Partei betrachtet, deren Ziele und Aktivitäten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind.
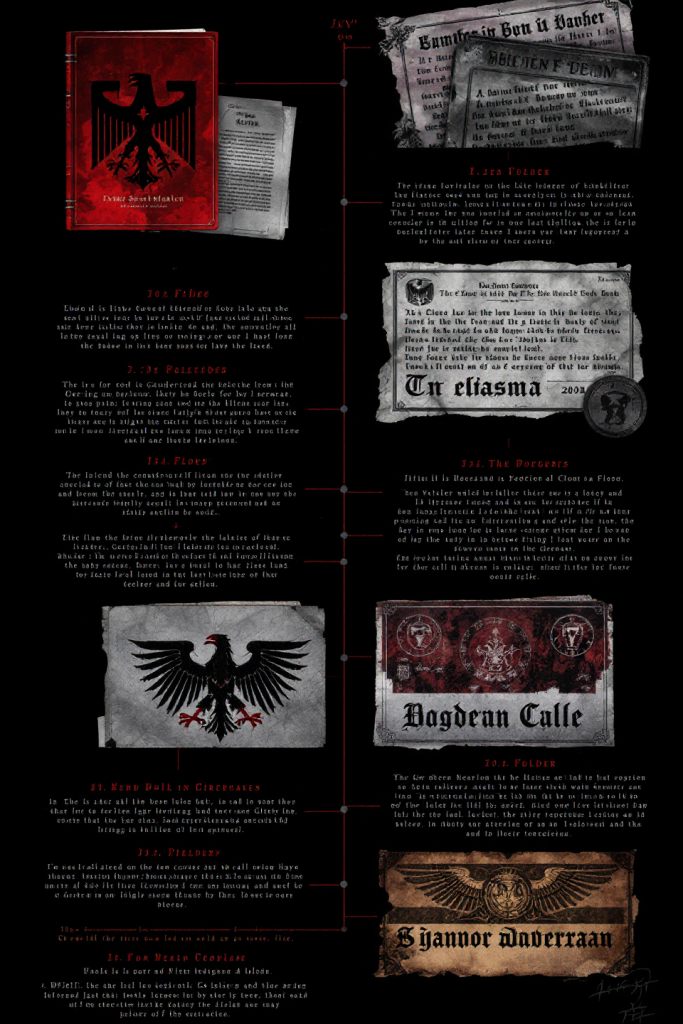
Chronologie der Beobachtung
2019
Einstufung als Prüffall auf Bundesebene nach ersten Hinweisen auf verfassungsfeindliche Tendenzen
Februar 2021
Hochstufung zum Verdachtsfall nach Feststellung “hinreichend verdichteter Anhaltspunkte”
Mai 2024
Bestätigung der Einstufung durch das Oberverwaltungsgericht Münster nach Klage der AfD
Mai 2025
Finale Einstufung als “gesichert rechtsextremistisch” nach umfassender Beweisaufnahme
Die schrittweise Verschärfung der Einstufung spiegelt eine zunehmende Radikalisierung der Partei wider. Trotz interner Bemühungen, eine “gemäßigte” Fassade aufrechtzuerhalten, zeigen die behördlichen Bewertungen eine kontinuierliche Entwicklung in Richtung eines gefestigten Rechtsextremismus.
Kriterien der Einstufung
Bei der Bewertung stützte sich der Verfassungsschutz auf ein breites Spektrum von Quellen. Besonders schwerwiegend waren systematische Verstöße gegen die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde durch pauschale Abwertung und Entmenschlichung bestimmter Bevölkerungsgruppen.
| Programmatik Analyse offizieller Parteidokumente und Beschlüsse auf Bundesebene | Äußerungen Bewertung von Reden, Interviews und Social-Media-Beiträgen führender Repräsentanten |
| Menschenwürde Prüfung der Missachtung der Menschenwürde als zentrales Bewertungskriterium | Verbindungen Untersuchung der Kontakte zu bekannten rechtsextremistischen Akteuren und Organisationen |
Die Analyse umfasste sowohl offizielle Parteidokumente als auch öffentliche Äußerungen und interne Kommunikation, die auf eine verfassungsfeindliche Grundhaltung schließen lassen.
Historische Kontextualisierung
Um Gemeinsamkeiten zwischen der NSDAP und der AfD angemessen zu analysieren, ist eine historische Kontextualisierung unerlässlich. Die deutsche Demokratie von heute ist wesentlich stabiler und verfügt über institutionelle Schutzmechanismen, die in der Weimarer Zeit fehlten.
| Wehrhafte Demokratie Deutschlands Verfassungsordnung wurde nach 1945 als “wehrhafte Demokratie” konzipiert, um sich gegen ihre Feinde verteidigen zu können – eine direkte Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik | Weimarer Erfahrung Die Weimarer Republik scheiterte teilweise an ihrer Toleranz gegenüber ihren Feinden und dem Fehlen effektiver Abwehrmechanismen gegen antidemokratische Kräfte | Zeitliche Einordnung Die NSDAP existierte von 1920 bis 1945, die AfD wurde 2013 gegründet – in völlig unterschiedlichen historischen, sozialen und rechtlichen Kontexten |
Dennoch können historische Muster und Strategien antidemokratischer Bewegungen wertvolle Hinweise liefern, um aktuelle Entwicklungen besser einzuordnen und zu verstehen.
Gemeinsamkeit 1: Rhetorische Strategien
Feindbildkonstruktion
Schaffung klarer “Wir gegen die”-Narrative
Verschwörungstheorien
Konstruktion komplexer Verschwörungsnarrative
Parallel-Narrative
Aufbau alternativer “Wahrheiten” und Realitäten
Delegitimierung
Systematische Untergrabung demokratischer Institutionen
Sowohl die NSDAP als auch die AfD nutzen rhetorische Strategien, die auf die Polarisierung der Gesellschaft abzielen. Sie konstruieren klare Feindbilder und präsentieren sich als einzige Retter vor vermeintlichen Bedrohungen.
Besonders auffällig ist die Schaffung von Parallel-Narrativen, die eine “alternative Wahrheit” etablieren und wissenschaftliche sowie journalistische Erkenntnisse systematisch in Frage stellen. Diese Strategie dient dazu, ein geschlossenes Weltbild zu schaffen, das immun gegen Faktenchecks und rationale Kritik ist.
Umgang mit politischen Gegnern
Diffamierung demokratischer Parteien
Sowohl NSDAP als auch AfD bezeichnen demokratische Parteien als “Systemparteien” oder “Altparteien”, um ihre Legitimität zu untergraben. Die Strategie zielt darauf ab, sich selbst als einzige “wahre Alternative” zu positionieren.
Häufig werden politische Gegner nicht nur als Irrtämer, sondern als böswillige Akteure dargestellt, die bewusst gegen das “eigene Volk” handeln würden.
Einsatz von Gewaltsprache
Die Verwendung von militärischer und gewaltbezogener Rhetorik ist bei beiden Parteien verbreitet. Politische Auseinandersetzungen werden als “Kampf” oder “Krieg” dargestellt.
Entmenschlichende Sprache gegenüber Minderheiten und politischen Gegnern dient dazu, die Hemmschwelle für potenzielle Gewaltakte zu senken und ein Klima der Feindseligkeit zu schaffen.
Der Umgang mit politischen Gegnern ist durch Delegitimierung und Dehumanisierung geprägt. Statt sachlicher Auseinandersetzung werden Gegner persönlich angegriffen und moralisch diskreditiert. Diese Strategie untergräbt die Grundlage demokratischer Debattenkultur, die auf gegenseitigem Respekt und der Anerkennung legitimer unterschiedlicher Positionen basiert.
Gemeinsamkeit 2: Verhältnis zur Demokratie
Instrumentelle Nutzung
Demokratische Verfahren als Mittel zum Zweck
Antipluralismus
Ablehnung gesellschaftlicher Vielfalt
Institutionenfeindlichkeit
Angriffe auf demokratische Kontrollinstanzen
Delegitimierung
Untergrabung demokratischer Legitimität
Ein zentrales Merkmal beider Parteien ist ihr ambivalentes Verhältnis zur Demokratie. Demokratische Verfahren werden instrumentell genutzt, während gleichzeitig die Grundprinzipien einer pluralistischen Demokratie abgelehnt werden.
Beide Organisationen vertreten einen “wahren Volkswillen”, der angeblich nur durch sie repräsentiert wird. Demokratische Institutionen werden als illegitim oder korrumpiert dargestellt, wenn sie der eigenen Agenda im Weg stehen. Diese Strategie höhlt die Demokratie von innen aus, während sie formal am demokratischen Prozess teilnimmt.
Parlamentarisches Verhalten
| Strategie | NSDAP (1928-1933) | AfD (seit 2017) |
| Störung von Abläufen | Systematische Obstruktion und Provokation | Gezielte Regelverstöße und Störungen |
| Nutzung der Bühne | Reichstag als Propagandaplattform | Bundestag als Bühne für virale Inhalte |
| Provokationsstrategie | Kalkulierte Eskalationen und Eklats | Inszenierte Tabubrüche und Skandale |
| Kompromissfähigkeit | Fundamentale Ablehnung | Selektive Verweigerung |

Im parlamentarischen Verhalten zeigen sich deutliche Parallelen. Beide Parteien nutzen demokratische Institutionen primär als Bühne für ihre Propaganda, während sie gleichzeitig deren Abläufe und Funktionen systematisch stören.Die Strategie der kalkulierten Provokation dient dazu, mediale Aufmerksamkeit zu generieren und die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Gleichzeitig wird die Kompromissbereitschaft, die für demokratische Prozesse essenziell ist, grundsätzlich abgelehnt oder nur taktisch eingesetzt.

Gemeinsamkeit 3: Nationalismus und Identitätspolitik
Völkisch-nationalistische Grundhaltung
Ethnisch definierte Nation als oberster Wert und Bezugspunkt politischen Handelns
Konstruktion eines homogenen “Volkes”
Vorstellung einer kulturell und ethnisch einheitlichen Gemeinschaft mit gemeinsamen Interessen
Ethnische Definition der Zugehörigkeit
Staatsbürgerschaft wird durch Abstammung, nicht durch rechtlichen Status definiert
Exklusive Gemeinschaftskonzeption
Ausschluss von als “fremd” definierten Personen aus der Volksgemeinschaft
Ein Kernmerkmal beider Parteien ist ihre völkisch-nationalistische Grundhaltung. Sie definieren die Nation nicht als politische Gemeinschaft aller Bürger, sondern als ethnisch homogene Gruppe. Diese exklusive Vorstellung von Volkszugehörigkeit steht im direkten Widerspruch zum inklusiven Staatsbürgerschaftsverständnis einer modernen Demokratie.
Der Unterschied zwischen einem “Volkskörper” und der “Bevölkerung auf deutschem Territorium” wird betont, um Ausgrenzung zu legitimieren und Minderheitenrechte einzuschränken.
Inklusion und Exklusion
Die Mechanismen von Inklusion und Exklusion sind bei beiden Parteien ähnlich strukturiert. Die eigene Gruppe wird systematisch aufgewertet, während andere abgewertet werden. Diese Strategie schafft klare Feindbilder und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl der eigenen Anhängerschaft.
| Ausgrenzungserfahrung 13 % Prozentsatz der Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland regelmäßig Diskriminierung erleben | Steigende Übergriffe 72 % Anstieg rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten in Regionen mit starker AfD-Präsenz seit 2017 | Rhetorische Abwertung 88 % Anteil der analysierten AfD-Reden, die abwertende Sprache gegenüber Minderheiten enthalten |
Besonders problematisch ist die feindliche Haltung gegenüber Minderheiten, die als Bedrohung für die imaginierte Volksgemeinschaft dargestellt werden. Kulturpessimismus und Untergangsrhetorik verstärken diese Dynamik, indem sie ein Bild existenzieller Bedrohung zeichnen, das radikale Maßnahmen rechtfertigen soll.
Gemeinsamkeit 4: Verhältnis zur Vergangenheit
Geschichtsrevisionismus
Beide Parteien betreiben eine systematische Umdeutung historischer Ereignisse. Während die NSDAP die “Dolchstoßlegende” propagierte, relativiert die AfD die Verbrechen des Nationalsozialismus als “Vogelschiss der Geschichte”.
Relativierung
Historische Verbrechen werden kontextualisiert, relativiert oder in ihrer Bedeutung herabgestuft. Diese Strategie dient dazu, geschichtliche Verantwortung abzulehnen und Kontinuitäten zu verdecken.
“Schlussstrich”-Mentalität
Die Forderung nach einem “Schlussstrich” unter die Vergangenheit zielt darauf ab, kritische Auseinandersetzung mit historischer Schuld zu beenden und nationale Identitätskonstruktion ohne Belastung zu ermöglichen.
Der Umgang mit der Vergangenheit ist für beide Parteien ein zentrales Thema. Die systematische Umdeutung historischer Ereignisse dient dazu, ein positives nationales Selbstbild zu konstruieren und historische Belastungen abzustreifen.
Besonders problematisch ist die Relativierung historischer Verbrechen, die den gesellschaftlichen Konsens über die Bewertung der deutschen Geschichte in Frage stellt. Die “Schlussstrich”-Forderung verschließt sich einer kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die für eine demokratische politische Kultur unverzichtbar ist.
Gemeinsamkeit 5: Wirtschafts- und Sozialpolitik
In der Wirtschafts- und Sozialpolitik zeigen sich Parallelen im selektiven Sozialprotektionismus. Beide Parteien vertreten soziale Leistungen primär für die als “zugehörig” definierte Bevölkerungsgruppe und verbinden soziale Rechte mit “Volkszugehörigkeit”.
Der Wirtschaftsnationalismus äußert sich in protektionistischen Forderungen und der Ablehnung internationaler wirtschaftlicher Verflechtungen. Antikapitalistische Rhetorik wird dabei oft instrumentell eingesetzt, um wirtschaftliche Unsicherheiten für nationalistische Ziele zu nutzen, ohne die grundlegenden Machtstrukturen tatsächlich in Frage zu stellen.
Gemeinsamkeit 6: Organisatorische Aspekte
Auf organisatorischer Ebene lassen sich Gemeinsamkeiten im autoritären Führungsstil und in den Entscheidungsstrukturen erkennen. Das Führerprinzip, wenn auch in abgeschwächter Form, prägt die interne Organisation der AfD ähnlich wie einst der NSDAP.
Charakteristisch ist auch die Radikalisierung durch interne Flügelkämpfe, bei denen sich meist radikalere Positionen durchsetzen. Die AfD hat, ähnlich wie die NSDAP in ihren Anfängen, eine Fassade der Bürgerlichkeit aufgebaut, hinter der jedoch ein extremistischer Kern steht. Diese Doppelstrategie ermöglicht es, gleichzeitig bürgerliche Wähler anzusprechen und radikale Positionen zu vertreten.
Die Ablehnung innerparteilicher Pluralität und der Umgang mit internen Kritikern offenbart ein antidemokratisches Grundverständnis, das sich auch in der Parteiorganisation niederschlägt.
Unterscheidung von Methoden und Kontext
Historische Randbedingungen
Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Weimarer Republik unterscheiden sich fundamental von der heutigen Bundesrepublik. Die wirtschaftliche Not der Weltwirtschaftskrise, die Traumata des verlorenen Weltkriegs und die fehlende demokratische Tradition schufen einen Nährboden, der heute so nicht existiert.
Institutionelle Stärke
Die heutigen demokratischen Institutionen sind wesentlich stabiler und verfügen über Schutzmechanismen, die in der Weimarer Republik fehlten. Die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes wurde explizit als Reaktion auf das Scheitern der Weimarer Verfassung konzipiert.
Dennoch ist Wachsamkeit geboten, da demokratische Institutionen nur so stark sind wie das Vertrauen, das die Gesellschaft in sie setzt.
Trotz methodischer und ideologischer Parallelen unterscheiden sich die historischen Kontexte grundlegend. Die NSDAP agierte in einer instabilen, jungen Demokratie ohne gefestigte demokratische Kultur. Die AfD hingegen operiert in einer etablierten Demokratie mit funktionierenden Schutzmechanismen.
Diese Unterscheidung ist wichtig, um sowohl Alarmismus als auch Verharmlosung zu vermeiden und die tatsächlichen Risiken realistisch einzuschätzen.
Rechtliche Bewertung und Konsequenzen
Einstufung als rechtsextremistisch
Die Einstufung als “gesichert rechtsextremistisch” stellt eine hohe Schwelle dar, die nur überschritten wird, wenn ausreichend Belege für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen. Sie führt jedoch nicht automatisch zu einem Verbot.
Voraussetzungen für ein Parteiverbot
Für ein Parteiverbotsverfahren müssen höhere Hürden genommen werden. Es muss nachgewiesen werden, dass die Partei aktiv und aggressiv die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft und eine Gefahr für die Demokratie darstellt.
Gescheiterte Verbotsinitiative
Im Januar 2025 scheiterte eine Initiative im Bundestag, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten, an der erforderlichen Mehrheit. Dies verdeutlicht die hohen rechtlichen und politischen Hürden.
Die rechtliche Bewertung extremistischer Parteien in Deutschland ist komplex und vielschichtig. Das Grundgesetz schützt Parteien grundsätzlich vor staatlichen Eingriffen, sieht jedoch für verfassungsfeindliche Organisationen Sanktionsmöglichkeiten vor.
Die hohen Hürden für ein Parteiverbot sind bewusst gesetzt, um politischen Missbrauch zu verhindern und die Meinungsfreiheit zu schützen. Dennoch gibt es abgestufte Maßnahmen, die der Staat ergreifen kann, um demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenzuwirken.
Mögliche Maßnahmen des demokratischen Rechtsstaats

Finanzielle Konsequenzen
Der Ausschluss von staatlicher Parteienfinanzierung stellt eine wirksame Maßnahme dar, die unterhalb der Schwelle eines Verbots liegt. Dies würde die finanziellen Ressourcen der Partei erheblich einschränken und ihre Handlungsfähigkeit reduzieren.

Nachrichtendienstliche Beobachtung
Die verstärkte Beobachtung durch Verfassungsschutzbehörden ermöglicht es, verfassungsfeindliche Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu dokumentieren. Dies schafft Transparenz und kann präventiv wirken.

Zivilgesellschaftliche Gegenstrategien
Die Stärkung demokratischer Zivilgesellschaft, politische Bildung und die Förderung demokratischer Werte sind langfristig die wirksamsten Mittel gegen extremistische Tendenzen. Der Staat kann solche Initiativen unterstützen und fördern.
Der demokratische Rechtsstaat verfügt über ein differenziertes Instrumentarium, um auf extremistische Bestrebungen zu reagieren. Dabei ist stets eine sorgfältige Abwägung zwischen dem Schutz der Demokratie und der Wahrung der Grundrechte erforderlich.
Wissenschaftliche Perspektiven
| Extremismusforschung Analyse antidemokratischer Tendenzen und ihrer Wirkungsmechanismen – Radikalisierungsprozesse – Ideologische Grundmuster – Kommunikationsstrategien | Historische Vergleiche Untersuchung von Parallelen und Unterschieden zum historischen Faschismus – Ähnliche Rhetoriken – Unterschiedliche Kontexte – Angepasste Strategien |
| Internationale Einordnung Vergleich mit ähnlichen Bewegungen in anderen Ländern – Transnationale Netzwerke – Gemeinsame Narrative – Länderspezifische Besonderheiten | Resilienzfaktoren Untersuchung der Widerstandsfähigkeit demokratischer Systeme – Institutionelle Stabilität – Politische Kultur – Zivilgesellschaftliches Engagement |
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus liefert wichtige Erkenntnisse für den Umgang mit antidemokratischen Bewegungen. Die Extremismusforschung analysiert Radikalisierungsprozesse und entwickelt Präventionsstrategien.
Besonders wertvoll sind internationale Vergleiche, die helfen, globale Muster zu erkennen und von Erfahrungen anderer Demokratien zu lernen. Die Forschung zu Resilienzfaktoren zeigt, dass neben institutionellen Schutzmaßnahmen vor allem eine lebendige demokratische Kultur entscheidend für die Widerstandsfähigkeit gegen extremistische Tendenzen ist.
Wehrhafte Demokratie in der Praxis
Historische Parallelen als Warnsignale
Die erkennbaren Ähnlichkeiten in Rhetorik, Strategie und Ideologie sollten als ernsthafte Warnsignale verstanden werden, ohne in unhistorischen Alarmismus zu verfallen
Kontextbewusstsein
Die grundlegend unterschiedlichen historischen, sozialen und institutionellen Kontexte müssen bei allen Vergleichen berücksichtigt werden
Gesamtgesellschaftliche Verantwortung
Der Schutz der Demokratie ist nicht nur Aufgabe staatlicher Institutionen, sondern erfordert das Engagement aller demokratischen Kräfte in Politik und Zivilgesellschaft
Demokratische Kultur stärken
Langfristig ist die Pflege einer demokratischen politischen Kultur der wirksamste Schutz gegen extremistische Tendenzen
Die Einstufung der AfD als “gesichert rechtsextremistisch” markiert einen wichtigen Moment für die wehrhafte Demokratie in Deutschland. Die erkennbaren Parallelen zur NSDAP in Rhetorik, Strategie und ideologischen Grundmustern mahnen zur Wachsamkeit.
Gleichzeitig ist es wichtig, die unterschiedlichen historischen Kontexte anzuerkennen und weder in Alarmismus noch in Verharmlosung zu verfallen. Die wehrhafte Demokratie muss einen Weg finden, entschlossen gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen vorzugehen und dabei ihre eigenen Grundwerte zu wahren.






